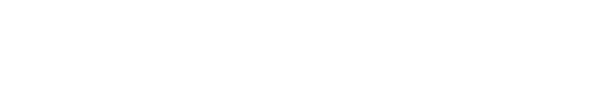DGP-Vizepräsident Andreas Müller: Psychosoziale Berufsgruppen müssen zwingend als dritte Berufsgruppe in der SAPV verankert werden

Beim Interfraktionellen Gesprächskreis (IFG) Hospiz im Deutschen Bundestag am 23. April verwies der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) Heiner Melching auf Lücken in der Antwort auf die Kleine Anfrage zur Flächendeckenden Hospizarbeit und Palliativversorgung in Deutschland vom 1. März 2024: Die stationäre Palliativversorgung sei nicht umfassend abgebildet, dies ließe sich u.a. an inkorrekten Angaben zur Anzahl der Palliativstationen ablesen. Gern stünde die DGP für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. „Insbesondere in Anbetracht der bevorstehenden Krankenhausstrukturreform sehen wir hier erheblichen und dringenden Handlungsbedarf.“
Die Fachgesellschaft setzt sich zudem für eine stärkere Berücksichtigung der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung vor allem im Bereich der Pflege ein, da sei „noch viel Luft nach oben“, so der DGP-Geschäftsführer.

Müller betonte: „Die psychosozialen Berufsgruppen müssen zwingend als dritte Berufsgruppe neben Ärzt:innen und Pflegekräften in der SAPV verankert werden.“ Im Rahmen des Interfraktionellen Gesprächskreises Hospiz hob der DGP-Vizepräsident außerdem die Bedeutung der Psychosozialen Berufsgruppen für die Suizidprävention hervor.
ANTWORT AUF KLEINE ANFRAGE: FLÄCHENDECKENDE HOSPIZARBEIT UND PALLIATIVVERSORGUNG IN DEUTSCHLAND