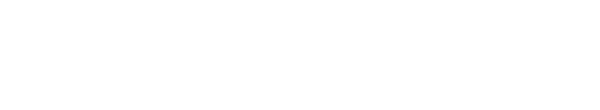Patienten haben Recht auf Therapieverzicht und -abbruch / Auch seltener Wunsch nach Suizidbeihilfe erfordert offenen, respektvollen und sensiblen Umgang / Beihilfe zum Suizid gehört nicht zu ärztlichen Aufgaben / Vertrauensvolle Gespräche über Sterbewünsche bahnen häufig die Annäherung an Alternativen zur Leidensminderung
Berlin, 16.04.2019. Die Einführung des § 217 im Strafgesetzbuch hat nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) keine negativen Auswirkungen auf die Palliativversorgung unheilbar erkrankter Menschen. Vor gut drei Jahren wurde das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung eingeführt. Dieses hat insbesondere bei Ärztinnen und Ärzten Verunsicherung ausgelöst, inwieweit sie sich in der Begleitung und Behandlung von schwerkranken Patienten, die nicht länger leben wollen, strafbar machen könnten. Elf Verfassungsbeschwerden gegen das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe sind seit 2017 beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängig, von denen sechs am 16./17. April im Mittelpunkt einer zweitägigen mündlichen Verhandlung vor dem BverfG stehen.
Als geladener Sachverständiger bekräftigt Prof. Dr. Lukas Radbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), heute vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die strafrechtliche Regelung mittels § 217 StGB die Palliativversorgung von schwerstkranken Menschen auch dann gewährleiste, wenn diese einen Sterbewunsch äußern. „Es zählt unbedingt zu den Aufgaben aller in der Palliativversorgung Tätigen, sich offen und respektvoll mit Sterbewünschen, wie auch Suizidwünschen im engeren Sinne, auseinanderzusetzen.“ Es sei zu kurz gegriffen, einen geäußerten Todeswunsch als konkrete Handlungsaufforderung im Sinne einer Bitte um Suizidbeihilfe zu verstehen, hob der Präsident der DGP hervor, in der fast 6.000 in der Palliativversorgung Tätige Mitglied sind.
Wunsch nach Ende einer unerträglichen Situation tiefer Not und Verzweiflung
Schwer kranke Menschen, die den Wunsch zu sterben äußern, wünschen oftmals das Ende einer ihnen unerträglichen Situation tiefer Not und Verzweiflung. Häufig ist es die Angst, Schmerzen, Luftnot oder anderen schweren Symptomen hilflos ausgeliefert zu sein, Angst vor dem Verlust körperlicher Funktionen und Fähigkeiten, Angst, beim Sterben alleingelassen zu werden, Angst vor Vereinsamung, Angst vor einem als würdelos empfundenen Zustand, Angst vor medizinischer Überversorgung oder Angst, dauerhaft Medizintechnik (zum Beispiel durch künstliche Beatmung) ausgeliefert zu sein. Viele Patienten begründen ihren Sterbewunsch auch mit der Sorge, anderen zur Last zu fallen.
In der Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden werden Ärztinnen und Ärzte insbesondere in der Palliativversorgung immer wieder mit Sterbewünschen ihrer Patienten konfrontiert. Die tägliche Praxis zeigt aber, dass dies oft den Wunsch nach einem offenen Gespräch zum Ausdruck bringe, nach alternativen Angeboten und nach einem gemeinsamen Aushalten der bedrückenden Situation. Entsprechend darf der Wunsch zu sterben keinesfalls tabuisiert werden. Im Gegenteil: Radbruch plädierte vor dem Bundesverfassungsgericht in aller Klarheit dafür, „die Äußerung von Sterbewünschen als Zeichen des Vertrauens zu werten. Erst ein offener Umgang mit diesem existentiellen Anliegen kann den Weg eröffnen, mit den betroffenen Patienten, deren Angehörigen und dem eingebundenen Team die palliativmedizinischen Optionen zur Linderung von Leid zu erörtern und zu versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden.“
Entsprechende Äußerungen von Patienten dürften nicht dazu führen, dass notwendige symptomlindernde Maßnahmen wie z.B. die Gabe von hochdosierten Opioiden zur Schmerzbehandlung unterlassen werden, erklärte der Anästhesiologe und Palliativmediziner Radbruch.
Patienten haben Recht auf Verzicht oder Abbruch jeder Art von lebensverlängernder Therapie
Für die kleine Zahl an schwerstkranken Menschen, bei denen mit den Möglichkeiten der Palliativversorgung keine ausreichende Leidenslinderung erreicht werden kann und für die eine palliative Sedierung nicht in Frage kommt, stünden Alternativen zu einem Suizid zur Verfügung. Patienten haben ein Recht auf Verzicht oder Abbruch jeder Art von lebensverlängernder Therapie. Dies umfasst zum Beispiel auch das Abstellen der kontrollierten Beatmung bei Patienten, die nicht mehr selbständig atmen können. Mit einer angemessenen Sedierung kann sichergestellt werden, dass dieser Prozess der Beatmungsbeendigung nicht als qualvoll empfunden wird. Ebenso kann jede andere lebensverlängernde Therapie beendet werden, zum Beispiel die Gabe von kreislaufunterstützenden Medikamenten oder Antibiotika, der Einsatz von Dialyseverfahren oder künstlicher Ernährung.
Auch entscheiden sich in seltenen Fällen immer wieder einmal schwerstkranke und leidende Menschen, auf Essen und Trinken zu verzichten. Die Entscheidung zu einem solchen Verzicht liegt alleine bei den Patienten, hebt die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin in einer aktuellen Stellungnahme hervor: „Wesentlich ist hier, dass der oder die Betroffene aus freiem Willen handelt und nicht durch eine krankhafte Essstörung oder eine andere psychiatrische Grunderkrankung in der Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist. Der freiwillige Verzicht auf Essen und Trinken kann ärztlich, pflegerisch und psychosozial begleitet werden, um gegebenenfalls Durst- und Hungergefühle effektiv zu lindern.“
Mitwirkung am Suizid gehört nicht zu ärztlichen Aufgaben / Bitte um Beihilfe zum Suizid ernst nehmen und respektieren
Unmissverständlich betont die wissenschaftliche Fachgesellschaft: „Unabhängig von der moralischen und ethischen Bewertung eines Suizids und der Bereitschaft, darüber offen und ohne Tabus zu sprechen, gehört die Mitwirkung daran nicht zu den ärztlichen Aufgaben. Der Suizid ist auch keine vom Arzt oder anderen Mitgliedern eines Behandlungsteams zu empfehlende Option.“
Fazit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin: „In der Palliativversorgung sollte die Bitte um Beihilfe zum Suizid auf jeden Fall ernst genommen und respektiert werden. Mit dem Patienten sollten über seine Wünsche und Ängste gesprochen werden und alternative Optionen zur Leidensminderung aufgezeigt werden. Dazu gehört eine umfassende Aufklärung über Möglichkeiten der medikamentösen und nichtmedikamentösen Schmerz- und Symptomkontrolle, unter Umständen auch über die Option der palliativen Sedierung, über Therapieverzicht und Therapiebegrenzung sowie den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Die neue gesetzliche Regelung berücksichtigt, dass in wenigen Einzelfällen von dem Behandler keine andere Möglichkeit gesehen wird als die Unterstützung beim Suizid, und lässt diese im Einzelfall und aus altruistischen Motiven heraus gewährte Hilfe straffrei.“