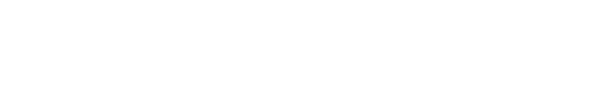Unter dem Motto Verantwortung in der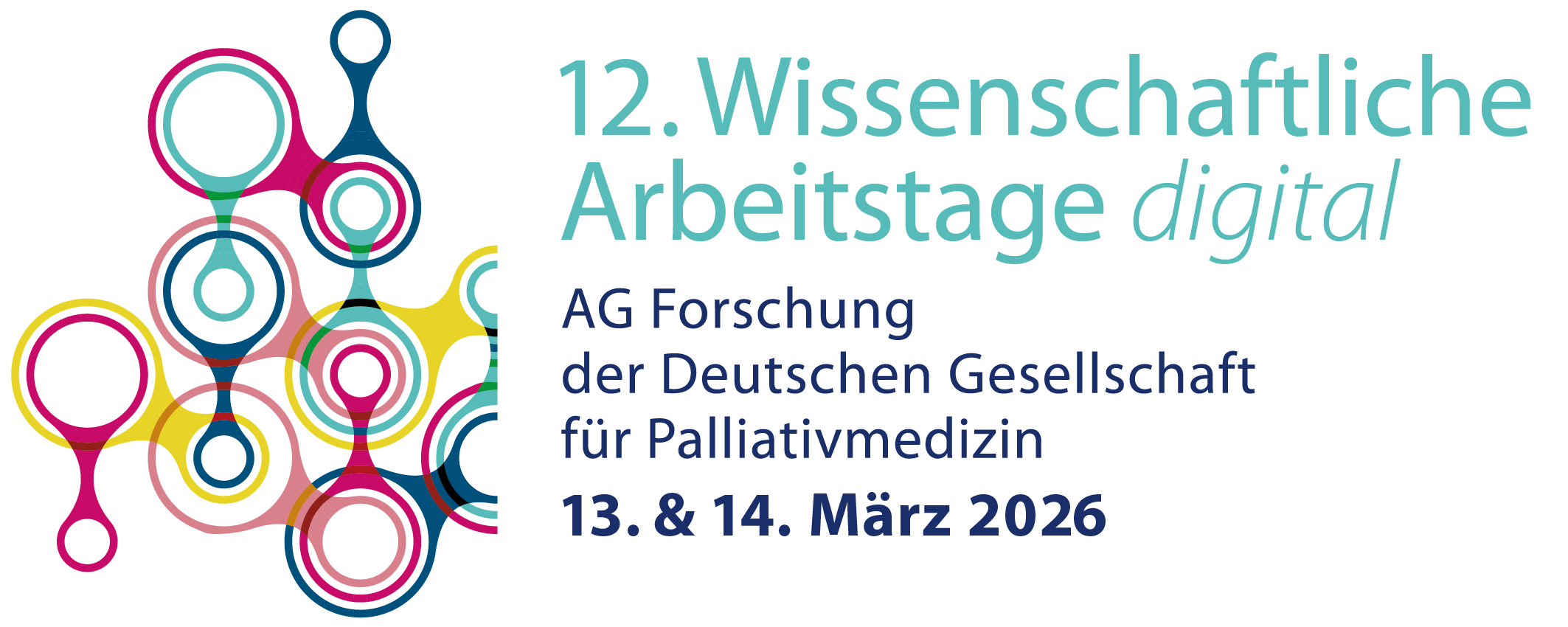 Palliativforschung finden am 13. und 14. März 2026 die Wissenschaftlichen Arbeitstage der AG Forschung (WAT 2026) zum 4. Mal im digitalen Format statt.
Palliativforschung finden am 13. und 14. März 2026 die Wissenschaftlichen Arbeitstage der AG Forschung (WAT 2026) zum 4. Mal im digitalen Format statt.
Die Palliativforschung steht vor ethischen Herausforderungen, die weit über die traditionellen institutionellen Rahmenwerke hinausgehen. Im Umgang mit vulnerablen Patient:innen sowie mit ihren Familien und Nahestehenden am Lebensende entstehen komplexe moralische Spannungsfelder, die eine vertiefte Reflexion über die Rolle als Forschende erfordern. Um das Recht auf bestmögliche Versorgung sicherzustellen, ist Forschung notwendig, da sie auf methodischer Grundlage Versorgungslücken, Zugangsbarrieren und Bedürfnisse von allen Beteiligten systematisch erfasst. Dabei steht die Palliativforschung vor der Herausforderung, die besonderen Schutzpflichten gegenüber schwerkranken Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Das verlangt eine Reflexion darüber, was Forschung darf und mit welchen wissenschaftlichen wie persönlichen Haltungen Forschende forschen.
Das Ziel der Wissenschaftlichen Arbeitstage 2026 ist es, diese vielschichtigen Herausforderungen gemeinsam zu durchdringen. Wir möchten einen Raum für offenen Austausch über moralische Integrität in der Forschung, persönliche Grenzen und die Stärkung von Wissenschaftler:innen im Umgang mit ethischen Dilemmata schaffen. Dabei sollen sowohl Nachwuchsforschende als auch erfahrene Kolleg:innen ihre Perspektiven einbringen, ins Gespräch kommen und voneinander lernen. Eingeladen werden sollen Akteur:innen, die die Palliativversorgung und ihre Erforschung seit der ersten Stunde begleiten und bei der Einschätzung von Entwicklungen und Veränderungen helfen.
Forschende als Person
In der qualitativen Palliativforschung kommt der forschenden Person eine zentrale Rolle zu, da Datenerhebung und -analyse wesentlich durch ihre kontextgebundene Wahrnehmung mitgeprägt werden – beeinflusst von sozialen, räumlichen und emotionalen Bedingungen, die in die Interpretation der Daten einfließen. Diese körperliche wie mentale Präsenz von Forschenden erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung, den eigenen Wert- und Moralvorstellungen und der eigenen Weltanschauung, denn wer wir sind, prägt, was wir tun und wie wir die Welt wahrnehmen.
Praktische Dilemmata
Jede Forschungspraxis konfrontiert uns mit konkreten ethischen Fragen, beispielsweise: Wie gehen wir als Forschende mit der Zumutbarkeit von Fragebögen für schwerkranke Menschen um? Welche moralischen Belastungen entstehen für Forschende in randomisierten kontrollierten Studien, wenn sie beobachten, dass es der Kontrollgruppe definitiv schlechter geht? Wie navigieren wir zwischen den oft widersprüchlichen Anforderungen von Ethikkommissionen, Datenschutzvorgaben und dem Forschungsauftrag? Inwieweit können wir Betroffene als Vertreter:innen von Patient:innen, Angehörigen und der Öffentlichkeit in Forschung einbeziehen?
Außerdem spiegelt die oft geringe finanzielle Förderung der Palliativforschung die gesellschaftlichen Prioritätensetzungen wider, die ethisch problematisch sein können.
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit Ihnen!
Ihr wissenschaftliches Komitee
Dr. Christian Banse, PD Dr. Dr. Maria Heckel, PD Dr. Franziska Herbst, Clara Rynas, Prof. Dr. Henrikje Stanze, PD Dr. Mitra Tewes
SAVE THE DATE
05. - 06.03.2027 WAT in Bremen