Krankenhausteams am Limit: "Wir überbringen Sterbenden letzte Nachrichten ihrer Familien"
Enge Kooperation zwischen Intensiv- und Palliativmedizin essentiell für Covid-19-Erkrankte, Angehörige und Mitarbeitende / Aufgaben der Palliativversorgung erheblich ausgeweitet / Was hilft: Solidarität & Flexibilität
Berlin, 21.12.20. „Die Covid-Erkrankten sind in den Kliniken auf die gemeinsame und vernetzte Versorgung aus Pneumologie, Intensivmedizin und Palliativmedizin angewiesen. Wir müssen derzeit damit leben, dass viele Menschen sterben. Unser Augenmerk muss aber trotz aller Belastung darauf liegen, wie sie sterben!“ erläutert Dr. Wiebke Nehls, Oberärztin der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin und Bereichsleitung Palliativmedizin sowie Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP).
„Der Aufgabenbereich in der Palliativmedizin ist erheblich größer geworden: Einerseits werden wir dringend auf den COVID-19-Stationen gebraucht, bei den isolierten Patientinnen und Patienten, zum anderen auf den Palliativstationen, in den Altenpflegeheimen, in den Hospizen und bei Schwerstkranken und deren Angehörigen zuhause. All dies unter neuen, veränderten und seit Wochen und Monaten äußerst schwierigen Bedingungen!“ so Nehls. Durch die Pandemie haben insgesamt deutlich mehr Menschen Unterstützungsbedarf durch Palliativversorgende. Gleichzeitig seien alle Bereiche im Gesundheitswesen durch massive Personalausfälle aufgrund von Erkrankungen oder Quarantäne-Verordnungen gefordert.
Erforderlich: "Notfallpalliativversorgung"
Die COVID-19-Pandemie macht eine „Notfallpalliativversorgung“ erforderlich: Das hohe Aufkommen von Patientinnen und Patienten mit rasch verlaufender palliativer Erkrankung erfordert, so Dipl.-Psych. und Psychoonkologe Urs Münch, Vizepräsident der DGP, flexible Maßnahmen zur psychosozialen und spirituellen Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen wie auch deren Angehörigen: „Kommunikation ist gerade in diesen stressbeladenen und bedrohlichen Notfallsituationen immens wichtig.“
Trotz der gegenwärtigen Rahmenbedingungen, hoher emotionaler Belastung und diverser Engpässe betont DGP-Präsident Prof. Dr. Lukas Radbruch: "Die in der Palliativversorgung tätigen Teams aus Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften sowie weiteren Berufsgruppen sind nicht nur mit schwerer Krankheit, Sterben, Tod und Trauer sehr vertraut, sondern haben den Grundgedanken der Kooperation, Koordination und Vernetzung um Patienten und Angehörige herum so verinnerlicht, dass auch unter Krisenbedingungen Brücken gebaut werden." Radbruch unterstreicht jedoch gleichzeitig: „Wir brauchen die Palliativversorgung an den Betten der Covid-Erkrankten, um diese - mit und ohne Intensivtherapie - in ihrem körperlichem und seelischem Leid gemeinsam adäquat zu versorgen und im Sterben so würdevoll wie möglich zu begleiten.“
Unterstützung von belasteten, schwerstkranken, sterbenden und trauernden Menschen
Den unerlässlichen Isolationsmaßnahmen und auch dem oft raschen Verlauf zum Trotz sind gute Möglichkeiten entwickelt worden, um Schwerstkranken und ihren Nächsten Begegnung, Austausch und Teilhabe zu ermöglichen: Da ist die vertraute Stimme am Telefon, die ferne Familie auf dem IPad, da bleiben Fotos, Berichte, Videos, Abschiedsrituale - oft übermittelt über das Team, das alles unternimmt, um die Verbindung zu An- und Zugehörigen zu halten und sie auch in den ersten Schritten der Trauer zu begleiten. Unterstützung dabei geben von der DGP mit herausgegebene „Empfehlungen zur Unterstützung von belasteten, schwerstkranken, sterbenden und trauernden Menschen in der Corona Pandemie aus palliativmedizinischer Perspektive“.
Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) ist seit einem Dreivierteljahr Teil eines dynamischen nationalen und internationalen Austauschs mit weiteren Fachgesellschaften, Kolleg*innen, Leistungsanbietern, Gesundheitsbehörden und der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik – all dies, so Prof. Dr. Claudia Bausewein, Vorstandsmitglied der DGP, Chefärztin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am LMU Klinikum München sowie Leiterin der dortigen Atemnotambulanz, mit Blick auf die bestmögliche Symptomlinderung und Verbundenheit mit jedem Einzelnen: „Wir müssen als Gesellschaft dringend dafür Sorge tragen, dass auch in der Covid-19-Pandemie kein sterbender Mensch in seiner Angst und Not allein gelassen wird.“
Empfehlungen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) unter Mitarbeit der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin finden Sie hier: https://www.dgpalliativmedizin.de/neuigkeiten/empfehlungen-der-dgp.html

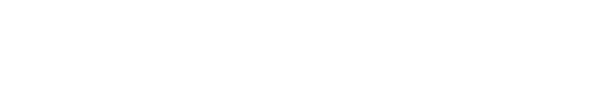


 Heute wurde das Programm für die 7. Wissenschaftlichen Arbeitstage der DGP zum Thema „Gemeinsam forschen – Grenzen überwinden – Digitale Herausforderung für die Qualität der Forschung" am 12. & 13. März 2021 veröffentlicht, ab sofort ist auch die Anmeldung möglich. Die Teilnahmegebühren für die Online-Veranstaltung betragen 39 Euro inklusive „Meet the Expert“ und Workshop. Begleitend ist eine e-Posterausstellung vorgesehen. Livechat und „Video-Wortmeldung“ während der Sitzungen sowie in den Pausen gewährleisten die Interaktion mit den Teilnehmenden.
Heute wurde das Programm für die 7. Wissenschaftlichen Arbeitstage der DGP zum Thema „Gemeinsam forschen – Grenzen überwinden – Digitale Herausforderung für die Qualität der Forschung" am 12. & 13. März 2021 veröffentlicht, ab sofort ist auch die Anmeldung möglich. Die Teilnahmegebühren für die Online-Veranstaltung betragen 39 Euro inklusive „Meet the Expert“ und Workshop. Begleitend ist eine e-Posterausstellung vorgesehen. Livechat und „Video-Wortmeldung“ während der Sitzungen sowie in den Pausen gewährleisten die Interaktion mit den Teilnehmenden.