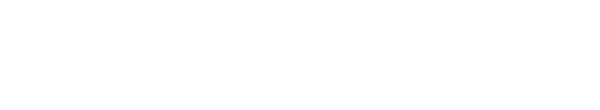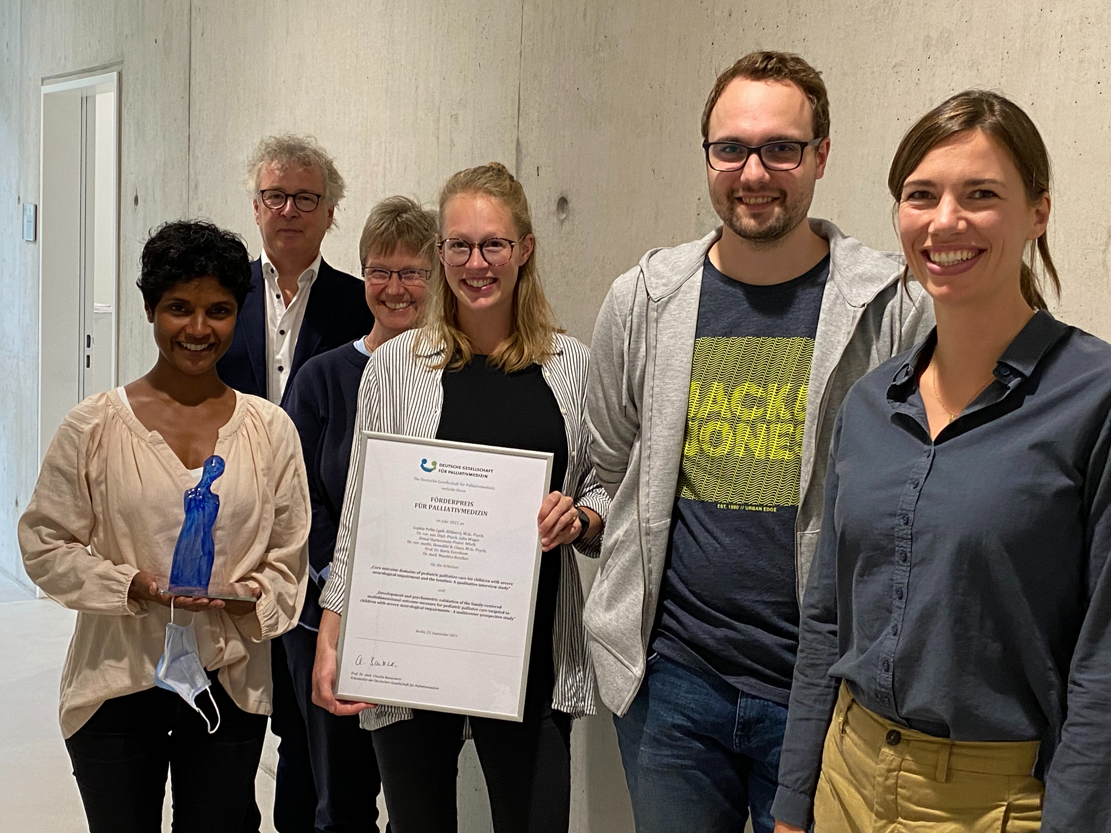Anfragen nach assistiertem Suizid nehmen zu – Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) veröffentlicht Empfehlungen für Mitarbeitende der Hospizarbeit und Palliativversorgung – Praxisnahe Handreichung betont Informationsanspruch von Patient:innen
Sterbenskranke Menschen wie auch deren Angehörige wenden sich zunehmend mit Anfragen nach einem assistierten Suizid an Mitarbeitende in der Hospiz- und Palliativversorgung. Das ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 deutlich spürbar. Deshalb hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) heute eine Handreichung für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Hospizarbeit und Palliativversorgung wie auch andere im Gesundheitswesen Tätige zum Umgang mit Anfragen zur Suizidassistenz veröffentlicht. DGP-Präsidentin Prof. Dr. Claudia Bausewein: „Suizidwünschen sollte immer mit Professionalität und Mitgefühl begegnet werden.“ Zum Ausdruck zu bringen sei laut der erfahrenen Palliativmedizinerin die Haltung: „Wenn Du sterben willst, berührt es mich und ich will Dir als Mensch beistehen“. Dabei kann es eine große Herausforderung für Fachkräfte der Hospizarbeit und Palliativversorgung darstellen, die Würde eines Menschen bis ins Äußerste – unter Umständen bis zum Wunsch, dieses Leben selbst zu beenden – zu bewahren.
Hospiz- und Palliativteams müssen Haltung zur Suizidhilfe entwickeln
In der öffentlichen Wahrnehmung werden Mitarbeitende und Institutionen der Hospizarbeit und Palliativversorgung – auch aufgrund der ursprünglichen im Jahr 2015 geführten Diskussion um Suizidhilfe als Ausnahmetatbestand für den Fall schwerer, unheilbarer Erkrankung – häufig als kompetent und sogar zuständig wahrgenommen, was in dieser Allgemeinheit in Frage gestellt werden muss. Dennoch: Mitarbeitende und Institutionen der Hospizarbeit und Palliativversorgung sollten sowohl die eigene Haltung zum Suizid reflektieren als auch auf institutioneller Ebene der einzelnen Einrichtungen, der Verbände und der jeweiligen Trägerstrukturen an der Positionsklärung und öffentlichen Darstellung der Haltung zum Thema Suizidhilfe mitwirken.
„Aufgrund vieler offener Fragen zur möglichen gesetzgeberischen Ausgestaltung und praktischen Umsetzung ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig.“ erklärt DGP-Geschäftsführer Heiner Melching heute bei Veröffentlichung der Handreichung. Neben Hintergrundinformationen zur aktuellen Gesetzgebung und Suizidalität finden Gesundheitsfachkräfte hier Empfehlungen für die Praxis, was in Gesprächen zu beachten ist und wie mit Anfragen verantwortungsvoll umgegangen werden kann. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin und die von ihr geführte Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland unterstützen gern Einrichtungen, die für ihre Teams Veranstaltungen zu diesem Thema planen.
Im konkreten Umgang mit Patient:innen, die nach Suizidhilfe fragen, empfiehlt die DGP diese Grundpfeiler: Wahrnehmen und Erkennen der Wünsche, Verstehen oder Akzeptieren der Ursachen und Funktionen des Todeswunsches, Angebot der palliativen Begleitung und Beratung sowie Suizidprävention. Wie das in der Praxis aussehen kann, wird in dem bei den DGP-Mitgliedertagen am 25. September 2021 finalisierten Papier dargelegt.
Infobedarf: Behandlungsbeendigung? Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken? Palliative Sedierung?
Vielen Patient:innen, die einen Todeswunsch äußern, ist zudem nicht bekannt, dass jede medizinische und pflegerische Maßnahme nur bei entsprechender Indikation und mit ihrem Einverständnis begonnen und weitergeführt werden darf, ergänzt DGP-Vorstandsmitglied Alexandra Scherg, Ärztin in Weiterbildung. Patient:innen und Ärzt:innen befürchten zudem, dass die Nichteinleitung oder Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen zwangsläufig mit stark belastenden Symptomen behaftet ist, so ihre Erfahrung – auch diese Fehleinschätzung muss korrigiert werden.
Außerdem unterstreicht DGP-Vizepräsident Dr. Bernd Oliver Maier: „Es ist wichtig, Patientinnen und Patienten Informationen über die Option der Beendigung lebenserhaltender Behandlungsmaßnahmen anzubieten.“ Dieser Anspruch auf Informationen müsse ebenso bezüglich des freiwilligen Verzichts auf Essen und Trinken (FVET) gelten. „Wenn die Last der Symptome auf physischer oder psychischer Ebene als unerträglich empfunden wird und eine ausreichende Symptomkontrolle auch mit allen Möglichkeiten der Symptomlinderung nicht oder nicht ausreichend schnell erreicht werden kann, ist zudem mit der Patientin oder dem Patienten die Option einer gezielten Sedierung zur Leidenslinderung zu besprechen.“, so Maier, Chefarzt für Palliativmedizin und interdisziplinäre Onkologie am St. Josefs-Hospital Wiesbaden.
Assistenz beim Suizid ist weder ärztliche Aufgabe noch Aufgabe der Hospiz- und Palliativversorgung
Prof. Dr. Claudia Bausewein, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am LMU Klinikum München, fasst zusammen: „Die Assistenz beim Suizid, also die direkte Hilfe bei der Durchführung, ist grundsätzlich keine ärztliche Aufgabe oder Aufgabe der Hospiz- und Palliativversorgung. Dennoch dürfen wir nicht weghören, wenn Sterbewünsche geäußert werden.“ Es sei absolut wichtig, dass Mitarbeitende und Institutionen der Hospizarbeit und Palliativversorgung die eigene Haltung zum Suizid reflektieren und sich mit dem Themenfeld der Suizidhilfe und der Suizidprävention auseinandersetzen. Dazu gehört das achtsame Erfragen und Dokumentieren von Todeswünschen bei hospizlich und palliativ begleiteten Menschen sowie die Kompetenz, darüber wertfrei zu kommunizieren. Wesentlich ist auch die differenzierte Aufklärung und Beratung über Möglichkeiten der Symptomkontrolle und des freiwilligen Verzichts auf Essen und Trinken am Lebensende.
Fazit der DGP: Teams und Einrichtungen benötigen zeitnah Konzepte zum Umgang mit Suizidwünschen, auch wenn die Kooperation mit Akteuren der Suizidhilfe von Einzelpersonen, Palliative Care-Teams oder Institutionen abgelehnt werden kann. Bei Kooperationsbereitschaft mit Sterbehilfeorganisationen sind zudem äußerst konkrete Fragen zu klären wie: Zutritt in eine Einrichtung, Duldung des assistierten Suizids in der Einrichtung und aktive Beteiligung von Mitarbeitenden an der Durchführung sowie die Definition verbindlicher “roter” Linien, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin ist sich bewusst, dass die vorgelegten Empfehlungen regelmäßig hinsichtlich der Notwendigkeit von Anpassungen überprüft werden müssen.
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) zum Umgang mit dem Wunsch nach Suizidassistenz in der Hospizarbeit und Palliativversorgung (Stand: September 2021)