DGP Zertifizierung von SAPV-KJ-Teams
Mit dem kontinuierlichen Auf- und Ausbau der pädiatrischen Palliativversorgung in Deutschland ist auch die Zahl der Teams für die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen (SAPV-KJ-Teams) stetig angestiegen, mittlerweile gibt es mehr als 30 SAPV-KJ-Teams in Deutschland.
Mit dem Rahmenvertrag zur Erbringung von Spezialisierter ambulanter Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche (SAPV-KJ) nach § 132d Abs. 1 Satz 1 SGB V vom 26.10.2022 werden Mindestanforderungen der Struktur- und Prozessqualität der SAPV-KJ-Teams bundesweit einheitlich definiert. Damit steigt auch die Bedeutung der Qualitätssicherung der SAPV-KJ.
Seit Januar 2025: Zertifizierungsverfahren von SAPV-Teams für Kinder und Jugendliche
Aus diesen Gründen hat die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) als maßgebliche wissenschaftliche Fachgesellschaft ein eigenes Zertifizierungsverfahren von SAPV-Teams für Kinder und Jugendliche etabliert.
Die DGP-Zertifizierung ermöglicht SAPV-KJ-Teams den Nachweis, dass sie in der Lage sind, die Versorgung ihrer pädiatrischen Patientinnen und Patienten nach spezifizierten und normierten Vorgaben zu erbringen. Diese Vorgaben berücksichtigen unter anderem die Anforderungen des Rahmenvertrages zur Erbringung von Spezialisierter ambulanter Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche (SAPV-KJ).
Ab sofort können SAPV-KJ-Teams eine DGP-Zertifizierung beantragen
SAPV-KJ-Teams können eine DGP-Zertifizierung beantragen und werden dann auf der Grundlage des Erhebungsbogens und in einem Audit von Fachprüfern mit ausgewiesener Expertise in der pädiatrischen Palliativversorgung bewertet.
Die DGP-Zertifizierung ist ein wesentlicher Schritt in der Qualitätssicherung der Hospizarbeit und Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in Deutschland. So können wir garantieren, dass schwerstkranke und sterbende Kinder und Jugendliche in Deutschland die bestmögliche pädiatrische Palliativversorgung erhalten!
Bei Interesse an der Zertifizierung eines SAPV-KJ-Teams wenden Sie sich bitte direkt an ClarCert, das Anfrageformular zur Zertifizierung finden Sie hier:
https://www.clarcert.com/systeme/palliativversorgung/system/zertifizierung-von-sapv-kj-teams.html

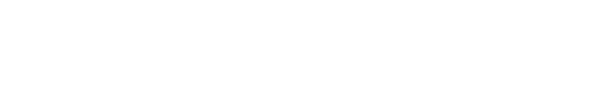

 geb. 1971, ein Sohn. Ausbildung zum Fachkrankenpfleger für Intensiv/Anästhesie & Palliative Care Fachkraft, Pflegeberater und Casemanager.
geb. 1971, ein Sohn. Ausbildung zum Fachkrankenpfleger für Intensiv/Anästhesie & Palliative Care Fachkraft, Pflegeberater und Casemanager. geb. 1964, Kinder- und Jugendarzt aus Leidenschaft. Im Jahre 2008 wurde ich auf den Lehrstuhl für Pädiatrische Palliativversorgung an der Universität Witten/ Herdecke berufen. Mein Team und ich haben gemeinsam das „Deutsche Kinderschmerzzentrum“ und das „Kinderpalliativzentrum“ an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln aufgebaut, welches ich ärztlich leiten darf.
geb. 1964, Kinder- und Jugendarzt aus Leidenschaft. Im Jahre 2008 wurde ich auf den Lehrstuhl für Pädiatrische Palliativversorgung an der Universität Witten/ Herdecke berufen. Mein Team und ich haben gemeinsam das „Deutsche Kinderschmerzzentrum“ und das „Kinderpalliativzentrum“ an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln aufgebaut, welches ich ärztlich leiten darf.